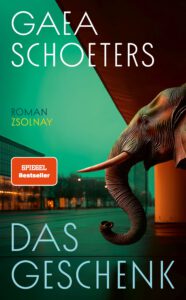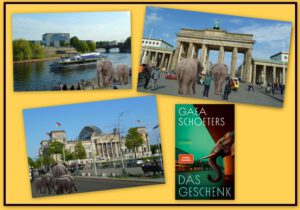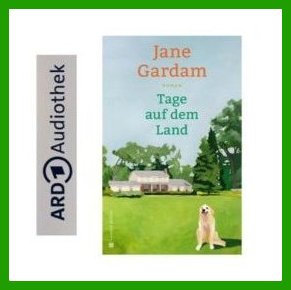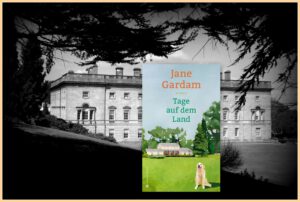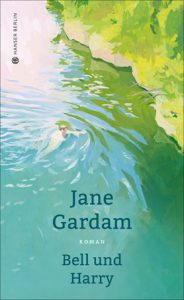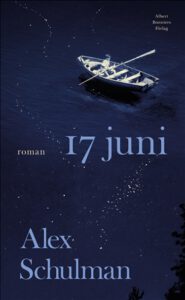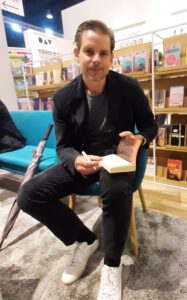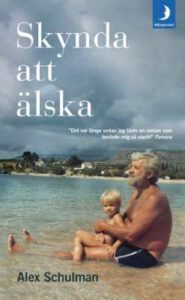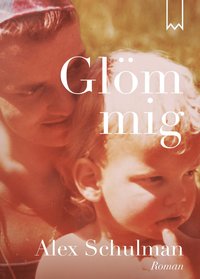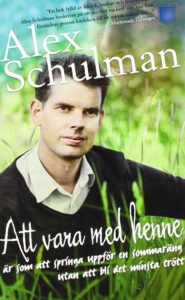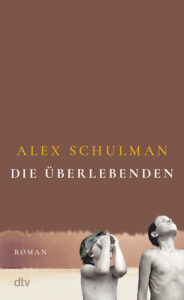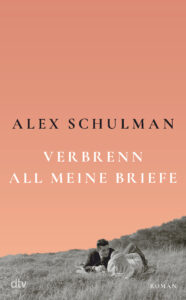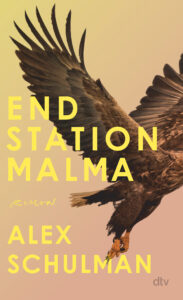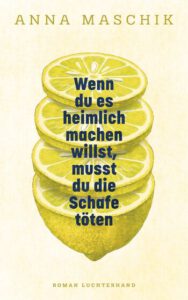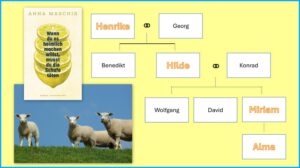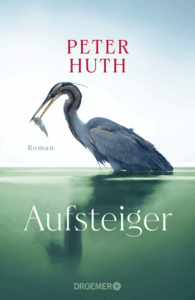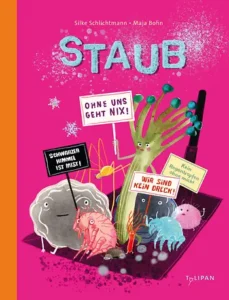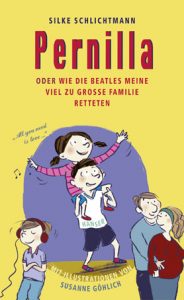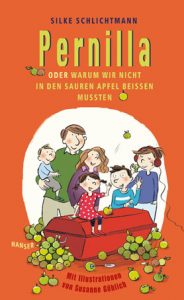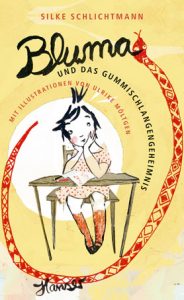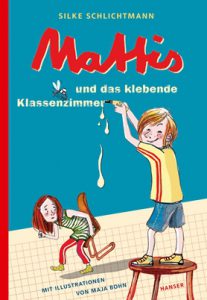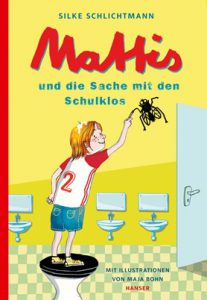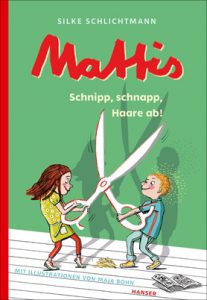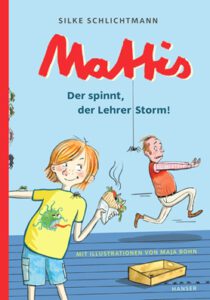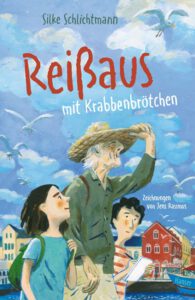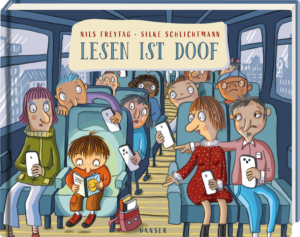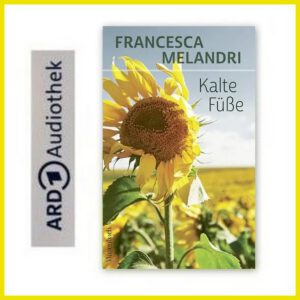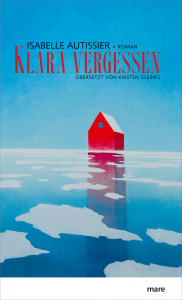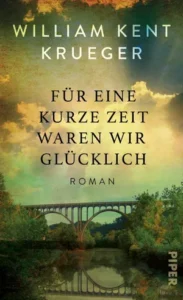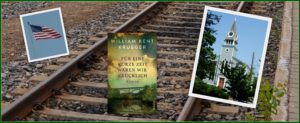Kino auf der Couch
Kino auf der Couch

Rom 2024. Auf der Couch der Dottoressa Maltesta in einer Altbauwohnung liegt seit viereinhalb Monaten zweimal wöchentlich der 62-jährige Filmregisseur Elia Fontana, genannt Eli. Seinen letzten Film hat er vor zehn Jahre gedreht. Nun ersetzt ihm die Therapeutin das Publikum, wenn er aus seinem Leben erzählt. Oder sind es nur Fantasien?
Der fehlende Vater ist die große Leerstelle in Elis Leben. Seine Mutter Francesca, eine Kommunistin aus großbürgerlicher italienischer Familie, war 1961 von einer Reise zum sozialistischen Großprojekt Goldstrand an der bulgarischen Schwarzmeerküste schwanger zurückgekehrt und hatte den Erzeuger ihres Kindes, einen aus der Ukraine stammenden Bulgaren namens Felix, nie wiedergesehen. Den zweijährigen Eli ließ sie bei ihrem zeitlebens vom Faschismus überzeugten Vater und ihrer schwachen Mutter zurück. Umso erstaunlicher scheint es, was Eli über seinen Vater zu berichten weiß. Er soll 1922 als Sechsjähriger mit seinem Vater Lew, einem Philosophieprofessor, aus Odessa geflohen sein, sich als Architekturstudent in Sofia dem Kommunismus angeschlossen haben und verantwortlich für den Bau von Goldstrand sein, einem „Musterbeispiel sozialistischer Erholungsarchitektur“ (S. 38). Wahrheit? Fiktion? Und was ist mit Vera, Felix‘ älterer Schwester, die sich auf der Flucht ins Schwarze Meer gestürzt haben soll, ein nie verwundenes Trauma für Lew und Felix, das Eli übernommen hat? Eli hat ihr Verschwinden in einem Film verarbeitet und seine Tochter nach ihr benannt, aber ist nicht auch dieses transgenerationale Trauma Fiktion?
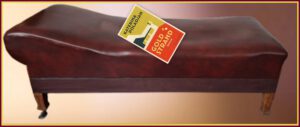
Realität und Fiktion
Katerina Poladjan, 1970 in Moskau geborene und seit Ende der 1970er-Jahre in Deutschland lebende, vielfach preisgekrönte Autorin, streift in ihrem sechsten Roman durch 100 Jahre europäische Geschichte und verbindet Ost und West in der Biografie ihres Protagonisten in gerade einmal 156 Seiten. Formal geben die klar strukturierten und ritualisierten Therapiesitzungen den Rahmen der ersten sechs Kapitel vor, die zugleich stark an filmische Sequenzen erinnern. Leise schleichen sich in den Text surreale Szenen ein, die bei mir zunächst Erstaunen, dann immer mehr Misstrauen auslösten. Im abschließenden siebten Kapitel verschwimmen Realität und Fiktion endgültig. Nun wird der Typus des unzuverlässigen Erzählers, der in diesem Fall ein professioneller Geschichtenerfinder ist, auf die Spitze getrieben, wie ich es nie vorher erlebt habe. Aber ist das verwunderlich bei einem Roman, der auf der berühmten, von einem italienischen Architekten aus Trienter Sandstein erbauten Potemkinschen Freitreppe in Odessa beginnt, deren Konstruktion ganz auf perspektivische Wirkung angelegt ist?
Ein kunstvolles literarisches Spiel
Überraschend leicht lässt sich der Roman lesen, trotz der Verschachtelung, der zahlreichen Bezüge zur griechischen Mythologie, zur Literatur und zur Philosophie, der Symbole, deren stärkstes der titelgebende Goldstrand ist, und dem Spiel mit Namen, selbst wenn man längst nicht alles erfasst. Der Ton schwankt zwischen Melancholie und Heiterkeit, letzteres vor allem in den Dialogen.
Was am Ende Realität, was Erinnerung, was Film und was reine Fiktion ist, bleibt der Einschätzung der Leserinnen und Leser überlassen und bietet reichlich Diskussionsstoff. Es bleibt neben starken Frauenfiguren das Bild eines einsamen, beziehungsunfähigen Mannes, geprägt von den Verwerfungen eines Jahrhunderts, eines in der Vergangenheit verharrenden Protagonisten auf der Suche nach den eigenen Wurzeln und der eigenen Identität, den nicht einmal seine Mutter versteht:
Warum musst du so bohren? Es gibt keine Geschichte vor deiner Geburt, es gibt keine Geschichte nach deiner Geburt […]. Die Geschichte bist du selbst, du brauchst keine Beglaubigung, du brauchst sie nicht, Eli. (S. 136)
Katerina Poladjan: Goldstrand. S. Fischer 2025
www.fischerverlage.de